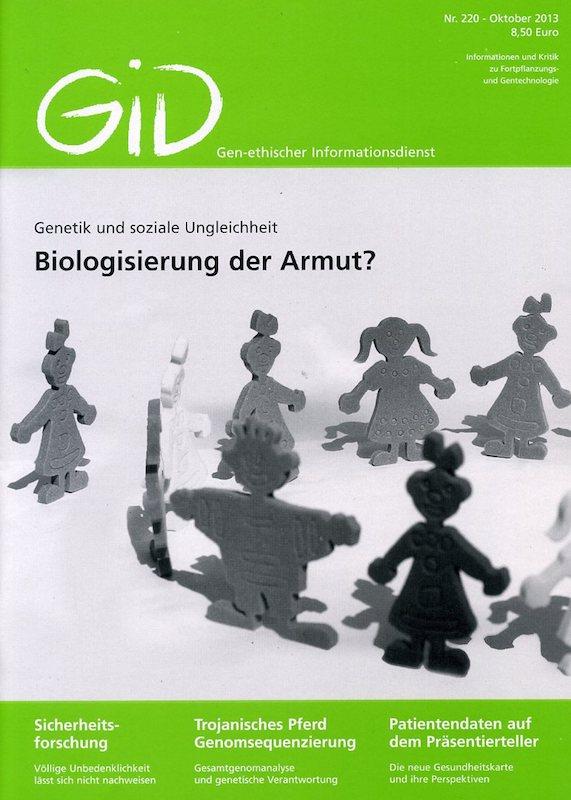Genetik und soziale Ungleichheit
Schwerpunkt
Soziale Ungleichheit gibt es nicht erst seit der Entstehung des Kapitalismus. Aber ist sie deshalb etwas, das menschliche Gesellschaften zwangsläufig - geradezu naturhaft - auszeichnet?
Impressum
GID 220, Oktober 2013, 29. Jahrgang, ISSN 0935-2481, Redaktion: Theresia Scheierling (ViSdP), Monika Feuerlein, Christof Potthof, Uta Wagenmann, Carolin Worstbrock